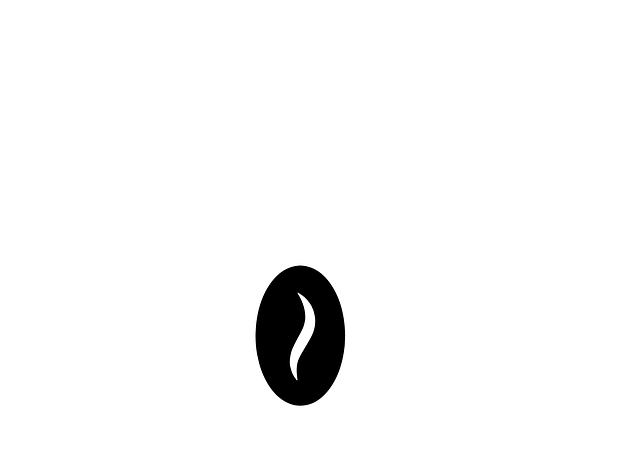"Ich habe jedenfalls eine andere Kapitalismustheorie als Ulrike Herrmann. Ich glaube nicht, dass es seit den frühen Tagen des Kapitalismus immer besser wurde - und jetzt einfach mit dem Wachstum nicht mehr klappt. Die Katastrophe war immer schon da und die Zerstörung ein Bestandteil dieses Wirtschaftsmodells. Die Manchesterkapitalisten konnten sich ihre Maschinen nur kaufen, weil sie Kapital aus dem Sklavenhandel hatten. Die derzeitige Produktionsweise ist gewalttätig und ökozidal. Es wäre gar nichts damit gewonnen, die Endergebnisse anders zu verteilen."
Philosophin über die Klimakrise: »Freiheit besteht in erfüllter Zeit« | Spiegel Online